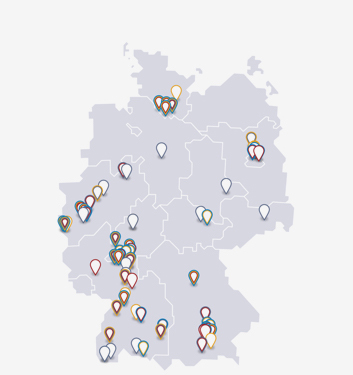Depression: Typische Symptome und Diagnose
Michelangelo und Luther, Goethe und Mozart, Marx und Sartre, Marie Curie und Virginia Woolf – die Geschichte kennt eine lange Liste prominenter Fälle depressiver Erkrankungen. Aus heutiger Sicht bestätigt das etwas wohl Bekanntes: Die Depression ist eine Krankheit mit verschiedenen Ausprägungen und vielen Gesichtern. Ausgehend von der individuellen Diagnose beginnt die professionelle Hilfe, die heute mit guten Erfolgschancen rechnet. Dass möglichst jede Depression überwunden wird, ist das gemeinsame Ziel von zahlreichen Institutionen und Initiativen in der Gesundheitsversorgung. Moderne Behandlungsmöglichkeiten sind unverzichtbar, um es zu erreichen.
Hinweis
Der folgende Artikel stellt mögliche Anzeichen, Ursachen bzw. Auslöser und Hauptsymptome von Depressionen sowie Theorien über Wirkweisen medikamentöser Behandlungen ausschnittsweise dar. Es handelt sich um allgemeine Informationen, die eine Diagnose bzw. die Beratung hinsichtlich der richtigen oder falschen Behandlung einer Erkrankung im Einzelfall nicht ersetzen. Die richtigen medizinischen Entscheidungen und Schritte sind individuell und durch ärztlichen Rat festzustellen.
Anzeichen einer Depression: seelische und körperliche Beschwerden
 Depressive Gedanken – auf dem Kupferstich „Melencolia“ von Albrecht Dürer, 1514.Nicht immer tritt eine Depression auf, weil es einen akuten Auslöser gibt. Aber auch wenn es einen konkreten Anlass gibt, gehen dann Leiden und Schmerz weit über das normale Maß hinaus. Von den „depressiven Tagen“ des normalen menschlichen Lebens unterscheidet sich die Krankheit unter anderem darin, dass die depressive Stimmung nicht binnen zwei Wochen von allein abklingt. Mögliche Krankheitszeichen der Depression sind eine ständige Freudlosigkeit, ein Interessensverlust bis zur inneren Leere und schnelle Erschöpfung. Oft kommen Schlafstörungen und Appetitlosigkeit hinzu, außerdem Schuldgefühle und Antriebslosigkeit bis hin zur völligen Erstarrung. Schwer Depressive schaffen es nicht, aus eigenem Antrieb aufzustehen oder ein Zimmer zu verlassen. Ihre Gefühlswelt ist von bleierner Hoffnungslosigkeit und Niedergeschlagenheit geprägt. Suizidgedanken sind bei schwer ausgeprägten Depressionen keine Seltenheit. Bei anderen Patienten und Patientinnen kann sich die Depression aber auch in Agitiertheit äußern. Sie erleben eine ziellose Unruhe. Eine anhaltende Reizbarkeit gehört zu den ersten Anzeichen einer Depression. Im Verlauf der Erkrankungen können verschiedene Symptome stärker und weniger stark auftreten. Die Depression ist eine behandlungswürdige Krankheit und schränkt Betroffene in der Lebensführung ein. Behandlungen erfolgen über die hausärztliche, neurologische oder psychotherapeutische Versorgung und auch in Kliniken.
Depressive Gedanken – auf dem Kupferstich „Melencolia“ von Albrecht Dürer, 1514.Nicht immer tritt eine Depression auf, weil es einen akuten Auslöser gibt. Aber auch wenn es einen konkreten Anlass gibt, gehen dann Leiden und Schmerz weit über das normale Maß hinaus. Von den „depressiven Tagen“ des normalen menschlichen Lebens unterscheidet sich die Krankheit unter anderem darin, dass die depressive Stimmung nicht binnen zwei Wochen von allein abklingt. Mögliche Krankheitszeichen der Depression sind eine ständige Freudlosigkeit, ein Interessensverlust bis zur inneren Leere und schnelle Erschöpfung. Oft kommen Schlafstörungen und Appetitlosigkeit hinzu, außerdem Schuldgefühle und Antriebslosigkeit bis hin zur völligen Erstarrung. Schwer Depressive schaffen es nicht, aus eigenem Antrieb aufzustehen oder ein Zimmer zu verlassen. Ihre Gefühlswelt ist von bleierner Hoffnungslosigkeit und Niedergeschlagenheit geprägt. Suizidgedanken sind bei schwer ausgeprägten Depressionen keine Seltenheit. Bei anderen Patienten und Patientinnen kann sich die Depression aber auch in Agitiertheit äußern. Sie erleben eine ziellose Unruhe. Eine anhaltende Reizbarkeit gehört zu den ersten Anzeichen einer Depression. Im Verlauf der Erkrankungen können verschiedene Symptome stärker und weniger stark auftreten. Die Depression ist eine behandlungswürdige Krankheit und schränkt Betroffene in der Lebensführung ein. Behandlungen erfolgen über die hausärztliche, neurologische oder psychotherapeutische Versorgung und auch in Kliniken.
Welche körperlichen Symptome und Beschwerden sind verbreitet?
Zu den bereits genannten Symptomen, die vor allem die Gefühle betreffen, kommen häufig sogenannte „somatische Symptome“. Das sind körperliche Beschwerden wie Kopf-, Rücken- oder Gliederschmerzen. Eine Meta-Studie der Uni Mainz bestätigte zudem, dass Erkrankte auch ein verändertes Zeitgefühl haben. Sie erleben die Zeit als quälend langsam, beinahe gleich einem Leben in Zeitlupe.
Hilfe in Akutsituationen
Wer Depression verspürt, fühlt sich oft allein mit seinem Leid. Dabei kann die Gegenbewegung ein Schritt zur Hilfe sein: sich einer nahestehenden Person anvertrauen, einem Arzt bzw. einer Ärztin, einem Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin oder einer kirchlichen Seelsorge. Die Telefonseelsorge ist in Deutschland täglich 24 Stunden kostenfrei und anonym erreichbar. Seelsorger:innen stehen per E-Mail, Chat und telefonisch unter 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222 zur Seite. Weitere Informationen unter: www.telefonseelsorge.de
Die Krankheit Depression
Seit mehreren Jahren nimmt die Zahl der Krankheitstage zu, die sich bei deutschen Versicherten jährlich aufgrund psychischer Erkrankungen ansammeln. Einen Anteil an dieser Entwicklung haben auch Fehltage aufgrund von Depressionen. Die Krankheit Depression führt daher auch zu erheblichen volkswirtschaftlichen Belastungen. Laut DAK ging im Jahr 2024 eine Zahl von rund 183 Fehltagen pro 100 Versicherte auf Krankschreibungen mit der Diagnose Depression zurück. In wissenschaftlichen Kreisen geht man allerdings nicht unbedingt von einer Zunahme an Erkrankungen aus, sondern führt den Anstieg auch auf einen offeneren Umgang mit der Krankheit zurück, der zwischen Behandelnden und Betroffenen stattfindet und mehr Hilfe für Betroffene bedeuten kann. Ob Frauen häufiger an Depressionen erkranken als Männer, ist statistisch betrachtet zu bejahen. Neben biologischen Gründen, wie etwa Unterschieden bezüglich des Hormonhaushaltes, kommen hierfür auch sogenannte „künstliche“ Gründe in Frage. Einschlägige Forschungsliteratur diskutiert beispielsweise eine Hypothese, nach der unterschiedliche Geschlechterstereotype dazu führen, dass Frauen trotz identischer Symptome eher eine Depression diagnostiziert wird als Männern. Im Allgemeinen sind neben körperlichen Faktoren auch soziale Risikofaktoren bekannt. So ist das Risiko, an einer Depression zu erkranken, bei ärmeren Menschen gegenüber wohlsituierten Menschen erhöht.
Was bedeutet es, an einer Depression zu leiden?
„Jede Empfindung wird zur Missempfindung“, beschreibt Prof. Dr. Ulrich Hegerl das Phänomen, der Inhaber der Johann Christian Senckenberg Distinguished Professorship an der Goethe-Universität Frankfurt ist und sich als Vorstandsvorsitzender in verschiedenen Vereinen engagiert, die sich für die Erforschung und Bewältigung depressiver Erkrankungen einsetzen.
Was können Angehörige tun, wenn jemand im Umfeld erkrankt?
Häufig fällt es Betroffenen schwer, über diese Missempfindungen zu sprechen. Dabei beginnt die Phase der Heilung oft mit Gesprächen, etwa beim Hausarzt, der Hausärztin oder mit Angehörigen. Gespräche können dazu ermutigen, eine medizinische Versorgung – in Form von Psychotherapie und/ oder medikamentöser Behandlung – in Anspruch zu nehmen. Sich die Belastung klein zu reden oder aus Scham zu verschweigen, kann den Leidensdruck hingegen zusätzlich erhöhen. Ein erschwerender Faktor ist daher, dass psychische Erkrankungen wie Depressionen, aber auch Suchterkrankungen, Angst-, Zwangs- und Essstörungen und weitere psychische Krankheitsbilder gesellschaftlich noch immer stigmatisiert sind. Ein verständnisvoller Umgang im engsten Umfeld ist hingegen ein wichtiger positiver Einfluss.
Symptome und ihre Anwendung in der Diagnostik
Eine von der beschriebenen Form der Depression (der „unipolaren Depression“) unterschiedene psychische Erkrankung ist die so genannte bipolare Störung oder auch manisch-depressive Krankheit. Bei ihr wechseln sich im Laufe von Monaten depressive Phasen mit extremen Hochphasen (Manien) ab. Die Krankheit hat andere Ursachen und muss anders behandelt werden als unipolare Depressionen.
Von normalen Formen der Traurigkeit oder depressiven Stimmung unterscheiden sich depressive Episoden durch eine ganze Reihe eindeutig definierter Merkmale. Treten nach einem Abklingen der Episode erneut Symptome auf, liegt eine rezidivierende (wiederkehrende) Depression vor. Zeigt sich die Depression über einen Zeitraum von ca. zwei Jahren behandlungsresistent, geht man von einer chronischen Depression aus. Ein Subtyp der chronischen Depression ist die sogenannte Dysthymie. Diese Diagnose kommt in Betracht, wenn einige Haupt- und Zusatzsymptome der depressiven Verstimmung mindestens ein Jahr (bei Kindern) bzw. zwei Jahre (bei Erwachsenen) anhalten. Der Schweregrad der Symptome ist vergleichbar mit einer leichteren depressiven Episode. Viele Menschen mit Dysthymie – wie auch ihre Angehörigen – verstehen die Situation eher als Teil der Persönlichkeit der betroffenen Person. So kann es passieren, dass Diagnose und Behandlung hinausgezögert werden.
Ein weltweit gültiger Katalog, die International Classification of Diseases (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO), listet die unterschiedlichen Depressionsformen auf und hilft Ärzten und Ärztinnen bzw. Psychotherapeuten und -therapeutinnen bei der Diagnose. Das gilt auch für die Bestimmung des Schweregrades im einzelnen Krankheitsfall.
Leitsymptome für eine „Depressive Episode“
Folgendes sind die Leitsymptome für eine „Depressive Episode“ nach der International Classification of Diseases (ICD 11) der Weltgesundheitsorganisation (WHO):
- Verstimmung und Verminderung des Antriebs
- verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit
- vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen
- Schuldgefühle und Gefühle der Wertlosigkeit
- negative und pessimistische Zukunftsperspektiven
- Neigung zu Selbstverletzungen und Suizidhandlungen
- Schlafstörungen und verminderter Appetit
Leichte depressive Episode: Zwei bis drei Symptome aus der Liste und Fortführung der meisten normalen Aktivitäten des täglichen Lebens.
Mäßige depressive Episode: Vier oder mehr Symptome aus der Liste und Schwierigkeiten beim Aufrechterhalten normaler Aktivitäten.
Schwere depressive Episode: Betroffene leiden in besonders schwerem Maße an mehreren der oben genannten Symptome. Suizidgedanken und -handlungen sind häufig. Die Symptome, die Stimmung und Verhalten betreffen, sowie die Suizidalität werden zudem meist von körperlichen Symptomen begleitet.
Den Schweregrad bestimmen: Tests und Skalen
Die Schwere der Erkrankung zu kennen, ist wichtig für die Art der Behandlung und die Verlaufskontrolle. Anhand spezieller psychologischer Tests unterscheiden Ärzte und Ärztinnen leichte, mittelschwere und schwere Depressionen. Zwei der meistbenutzten Tests sind die Hamilton Rating Scale of Depression (HRSD) und die Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS). Beide Tests liegen heute in verschiedenen Varianten vor. Grundsätzlich dienen sie der strukturierten Befragung von Betroffenen hinsichtlich ihrer Symptome und deren Ausprägung. Die Skalen sind auch wichtig, um die Leistungsfähigkeit verschiedener antidepressiver Behandlungen vergleichen zu können, zum Beispiel im Rahmen von Studien.
Die hohe Komorbidität depressiver Erkrankungen
Depressive Erkrankungen zeigen eine hohe Komorbidität. Das bedeutet, sie treten häufig in Zusammenhang mit anderen psychischen Störungen auf. Zwischen diesen können unterschiedliche Beziehungen bestehen. So kann eine depressive Grunderkrankung mit dazu beitragen, dass sich eine Substanzabhängigkeit entwickelt. Die Kausalität kann auch wechselseitig auftreten, etwa zwischen einer generalisierten Angststörung und einer depressiven Störung. Auch über die Entstehungsgründe können weitere psychische Erkrankungen mit der depressiven Störung in Zusammenhang stehen, z.B. wenn Verlust- und Missbrauchserfahrungen Auslöser sind. Eine statistische Untersuchung hat ermittelt, dass bei Vorliegen einer unipolaren depressiven Störung in den letzten 12 Monaten etwa 60% der Befragten mindestens eine und etwa 24% drei und mehr zusätzlichen psychische Erkrankungen erlitten.
Wie kommt es zu Depressionen?
Durch Jahrzehnte psychiatrischer Forschung kennt man mittlerweile viele Teilaspekte der Krankheit. Aber keine Theorie kann bisher alles, was Forschende und Behandelnde bei dieser Krankheit beobachten, befriedigend erklären. Sicher ist: Depression ist nicht nur eine „Krankheit der Gedankenwelt“, sondern geht mit messbaren Veränderungen im Gehirn einher – wobei eine Trennung zwischen Gedanken und Gehirnzellen ohnehin künstlich ist, sind doch Denkprozesse aller Art unweigerlich mit Veränderungen in der Hirnarchitektur und dem Gehirnstoffwechsel verbunden.
Gefühle aus dem Lot – Ursachen und Auslöser
Warum erkranken Menschen an Depressionen? Als Ursachen/ Auslöser einer Depression kommen nach heutigem Stand der Forschung immer sowohl psychosoziale als auch neurobiologische Aspekte in Frage. Psychosoziale Faktoren, die die Anfälligkeit erhöhen, sind zum Beispiel traumatische Ereignisse wie Gewalt- und Missbrauchserfahrungen oder Vernachlässigung insbesondere in der frühen Kindheit. Dazu kommen psychosoziale Auslöser wie ein Trauerfall oder andere belastendende Ereignisse, andere Krankheiten oder auch das Wegfallen einer Lebensaufgabe. Depressive Episoden, die mit dem Ruhestand zusammenfallen, werden daher auch mit dem sog. „Empty-Desk-Syndrom“ assoziiert. Das sog. „Empty-Nest-Syndrom“ wiederum weist auf Schwierigkeiten bei der Anpassung an das „leere Familiennest“ hin. Der folgende depressive Zustand zeigt sich psychosozial betrachtet u.a. durch Zurückgezogenheit und Freudlosigkeit. Auf psychosozialer Ebene interveniert dann die Psychotherapie. Eine erhöhte Anfälligkeit kann aber auch neurobiologisch durch genetische Faktoren beeinflusst sein. Eine Zunahme an Stresshormonen kann als neurobiologischer Auslöser einer Depression identifiziert werden.
Gehirnstoffwechsel und Signalübertragung
Eine längere Zeit favorisierte, aber auch vielfach wieder bezweifelte Theorie geht davon aus, dass Störungen in der Signalübertragung von Zelle zu Zelle im Gehirn im Zentrum der Krankheit stehen. Betroffen seien demzufolge insbesondere Synapsen, das heißt Nervenschaltstellen, die zur Übertragung die Botenstoffe Serotonin oder Noradrenalin benutzen (siehe Infobox). Serotonin, so ist bekannt, ist ein bevorzugter Neurotransmitter von Nervenzellen, die Emotionen verarbeiten. Hinweise darauf wurden vor allem in den 1960er-Jahren an den US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) erarbeitet. Dies wurde zu einer fruchtbaren Grundlage für die Entwicklung wirksamer Antidepressiva , auch wenn die genannten Botenstoffe vielleicht auf andere als die vermutete Weise mit Depressionen zusammenhängen.
Wie funktionieren Synapsen?
Zwischen Nervenzellen gibt es Schaltstellen, die sogenannten Synapsen. An diesen berühren sich die Zellen fast – nur ein kleiner Spalt trennt sie noch. Gelangt ein Nachrichtensignal, das den Ausläufer einer Nervenzelle entlanggewandert ist, an eine solche Synapse, kann es die Lücke zur zweiten Zelle nicht überspringen. Um das Signal dennoch weiterzugeben, schüttet die erste Zelle aus Vorratsbehältern kleine Portionen eines Botenstoffes (Neurotransmitter) aus, der sich im Spalt verbreitet und Empfangsantennen auf der dem Spalt zugewandten Seite der zweiten Zelle erreicht, die Rezeptoren. Die zweite Zelle reagiert daraufhin ihrerseits mit einem elektrischen Signal. Die erste Zelle nimmt dann den ausgeschütteten Neurotransmitter wieder auf und ist bereit, das nächste Signal zu übertragen. Nervenzellen benutzen unterschiedliche Neurotransmitter. Um die 60 verschiedene sind bekannt, unter ihnen Serotonin, Noradrenalin, Acetylcholin und Dopamin. Antidepressiva beeinflussen behutsam die Signalübertragung in bestimmten Synapsen, beispielsweise dadurch, dass sie die Wiederaufnahme ausgeschütteter Neurotransmitter in die Nervenzellen etwas bremsen.
Eine Beobachtung, die schon seit langem diesem Erklärungsansatz entgegensteht, ist, dass zwar in der Tat eine Wirkung der mit Blick auf Serotonin- und Noradrenalin entwickelten Antidepressiva auf die Synapsen binnen Stunden messbar ist, die stimmungsaufhellende Wirkung sich jedoch frühestens nach etwa zwei Wochen einstellt.
Seit einigen Jahren sind Forschende noch anderen Veränderungen im Gehirn depressiver Patienten und Patientinnen auf der Spur. So haben sie beispielsweise festgestellt, dass bei Langzeitdepressiven eine für Lernen und Gedächtnis bedeutsame Hirnregion, der Hippocampus, deutlich kleiner als bei gesunden Vergleichspersonen ist. Medikamente gegen Depressionen können das Wachstum neuer Hirnzellen im Hippocampus fördern, wie Forschende in den USA bei Ratten herausgefunden haben. Diesen neuen Zellen kommt möglicherweise eine große Bedeutung bei der Überwindung der Depression im Gehirn zu. Dass ihre Bildung durch Zellteilungen einige Zeit in Anspruch nimmt, könnte erklären, warum die Wirkung der Medikamente erst nach zwei Wochen spürbar wird.
Forschende des Universitätsklinikums Freiburgs wiederum befassten sich mit dem „verzögerten“ Effekt von antidepressiven Medikamenten. Ausgehend von ihren Beobachtungen bei Mäusen beschrieben sie eine positive Beeinflussung von Lern- und Anpassungsmechanismen im Gehirn. Eine durch die Gabe von Medikamenten erreichte Verbesserung der sogenannten synaptischen Plastizität bedeute eine bessere Fähigkeit des Gehirns, sich anzupassen und neue Informationen aufzunehmen. Das könnte auch positive Erfahrungen betreffen, die beispielsweise im Rahmen einer Psychotherapie gemacht werden. Das Gehirn würde sich in Wechselwirkung besser erholen können.
Die Rolle der Gene
Bekannt ist inzwischen, dass es für Depressionen genetische Einflüsse geben muss, denn sie treten in manchen Familien gehäuft auf. Eine Reihe von Genen wurden gefunden, die je nach ihrer Ausprägung das Risiko, an Depression zu erkranken, günstig oder ungünstig zu beeinflussen. Im Wechselspiel mit Umwelteinflüssen wie dem sozialen Umfeld, Stress und Schicksalsschlägen könnten diese und weitere, noch unentdeckte Anlagen den Ausschlag geben, wenn jemand „auf der Kippe“ steht. Ein Gen hingegen, das unweigerlich Depression auslöst, gibt es nicht.