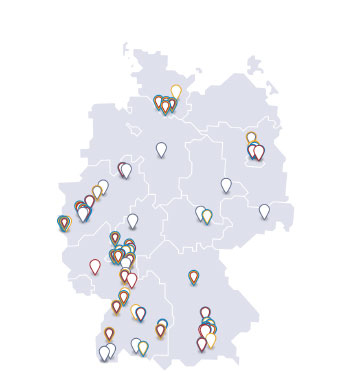Glukose-responsive Insulinmedikamente: Wie ein Hormon lernt, nur zu wirken, wenn es soll
Die Möglichkeit, immer wieder Insulin von außen zuzuführen, erlaubt Menschen mit Typ-1-Diabetes ein leidlich normales Leben mit einer weitgehend kontrollierten Blutzuckerkonzentration – dem Blutzuckerspiegel. Doch auch die neueste Pumpen- und Sensortechnik entbindet sie nicht davon, ständig die Therapie vorausplanen zu müssen; ebenso ist die Gefahr der „Unterzuckerung“ – bei der Ohnmacht durch einen zu tief gefallenen Blutzuckerspiegels droht – noch nicht vollständig gebannt. Doch Pharmafirmen und Institute arbeiten nun an Insulinmedikamenten, die selbst den Blutzuckerspiegel „messen“ und ihre Wirksamkeit darauf abstimmen.

Arzt hilft einem Jungen mit Typ-1-Diabetes, die Insulinpumpe anzulegen
Blutzucker und Insulin
Mit Blutzucker ist Glukose gemeint, die im Blut gelöst ist. Für die meisten Organe ist dieser auch Dextrose oder Traubenzucker genannte Stoff der hauptsächliche energieliefernde Treibstoff. Seine Konzentration heißt auch „Blutzuckerspiegel“.
Wie süß ist das Blut?
Obwohl der Blutzucker Glukose der Haupttreibstoff des Menschen ist, ist seine Normalkonzentration im Blut nicht besonders hoch: Wenn man von einem der üblichen Dextrose-Täfelchen aus dem Lebensmittelhandel ein knappes Drittel abbricht und in einem ganzen Liter Wasser auflöst, erreicht man ungefähr die Konzentration des Blutzuckers (oberer Wert).
Der Blutzucker ist eine ambivalente Sache: Einerseits wird er unbedingt für die Energieversorgung gebraucht; und wenn im Blut zu wenig zirkuliert, droht Bewusstlosigkeit. Andererseits beschädigt Glukose die Proteine in den Blutkörperchen, in den Blutgefäßwänden und auch in den Zellen darum herum. Der Körper kann das reparieren, aber nicht beliebig schnell. Deshalb versucht er dafür zu sorgen, dass der Blutzuckerspiegel nicht allzu sehr um einen Kompromisswert herum schwankt: Ein Wert zwischen ungefähr 0,6 Gramm pro Liter und ca. 1,4 Gramm pro Liter (= 60 bis 140 mg/dl oder 3,3 bis 7,8 mmol/l) ist ok.
Mit Hilfe von Hormonen reguliert der Körper den Blutzuckerspiegel und was mit der Glukose geschieht. Eins der Hormone ist das Insulin. Es wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet und über das Blut verteilt. Es schließt die meisten Zellen im Körper – etwa Muskelzellen – überhaupt erst für Glukose auf: Nur, wenn diese von Insulin berührt werden, lassen sie Glukose zu sich herein. Als Kontaktstellen dienen Insulin-Rezeptor-Moleküle in den Zellmembranen.
Damit sich nicht immer mehr Insulin im Blut ansammelt, fischt die Leber ständig wieder Insulinmoleküle aus dem Blut heraus. Wird erneut Insulin gebraucht, muss die Bauchspeicheldrüse nachproduzieren.
Diabetes Typ 1
Aus noch ungeklärten Gründen zerstört bei manchen Menschen das Immunsystem die Insulin-produzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse, was zu einem dauerhaften Verlust der Blutzucker-Kontrolle führt. Dann spricht man von Diabetes Typ 1.(1)
Meistens macht sich der Immunangriff in einem Alter zwischen 10 und 19 Jahren erstmals bemerkbar. Er kann aber auch schon früher erfolgen, oder auch erst bei Erwachsenen. Unbehandelt führt Typ-1-Diabetes zum Tod.
Glücklicherweise kann die Krankheit seit den 1920er-Jahren gut behandelt werden, indem Insulin von außen zugeführt wird. Viele Menschen mit Typ-1-Diabetes nutzen dafür mittlerweile eine Insulinpumpe. Letztere ist über einen kurzen Katheter mit dem Unterhautfettgewebe verbunden und muss alle paar Tage neu gesetzt werden. Von dort tritt das Insulin dann allmählich ins Blut über. Wieviel Insulin pro Minute gepumpt wird, lässt sich regeln – bei „closed loop“-Systemen sogar teilweise automatisiert, weil die Pumpe direkt mit einem Blutzuckersensor verbunden und mit einem komplexen Algorithmus ausgestattet ist. Trotzdem erreicht das Pumpeninsulin das Blut immer erst zeitversetz; und die Pumpe braucht für das richtige Dosieren immer wieder Informationen über geplante Tätigkeiten und äußere Umstände, etwa ein körperliches Training oder eine Erkältung (was den Insulinbedarf erhöht).
Die größte akute Gefahr für Menschen mit Typ-1-Diabetes sind Situationen, in denen zu viel Insulin im Blut zirkuliert und den Blutzuckerspiegel zu weit nach unten treibt. Sie heißen „Unterzuckerung“ oder „Hypoglykämie“ und können zu einer Ohnmacht führen. Eine wesentliche Verbesserung für Menschen mit Typ-1-Diabetes wären daher Insulin-Medikamente, die gewissermaßen selbst den Blutzuckerspiegel messen und unmittelbar darauf durch Steigern oder Abschalten ihrer Wirksamkeit reagieren.
Blutzucker-responsive Insulin-Medikamente
Der Gedanke an selbstanpassende – sogenannte Blutzucker-responsive – Insulinmedikamente ist schon rund 50 Jahre alt. Bislang konnte er aber noch nicht verwirklicht werden.
Doch arbeiten derzeit mehrere Forschungsteams in Instituten und Unternehmen daran. Einige werden dabei unterstützt durch Fördermittel im Rahmen der „Type 1 Diabetes Grand Challenge“; einem von der britischen Stiftung Steve Morgan Foundation und der Organisation Breakthrough T1D ausgerufenen Programm für neue Insulinmedikamente.
Nanopartikel
Mehrere Projekte arbeiten mit unterschiedlichen Varianten der gleichen Strategie: Insulinmoleküle werden mit einer zweiten Sorte Molekülen gemischt, mit denen sie sich lose verbinden – ähnlich wie ein Luftballon mit der Wand, wenn man ihn vorher an einem Wollpullover gerieben hat. Aus diesem Gemisch werden Nanopartikel geformt: Kügelchen, die so klein sind, dass man sie nicht einmal in einem Lichtmikroskop als solche erkennen kann. Eine Suspension mit diesen Kügelchen wird dann unter die Haut gespritzt und verbleibt dort einige Tage an Ort und Stelle. Dort zeigt sich dann auch der Clou: Wenn die Nanopartikel mit Glukose in Kontakt kommen, löst sich Insulin aus dem Gemisch und gelangt ins Blut. Je höher der Blutzuckerspiegel, desto mehr Insulin wird pro Minute herausgelöst. Wenn der Blutzuckerspiegel sehr tief fällt, wird kein weiteres Insulin aus den Nanopartikeln herausgelöst.
Natürlich funktioniert das nur aufgrund der besonderen Eigenschaften der Stoffe, mit denen das Insulin in den Nanopartikeln vermengt wird. Während die Monash University in Australien [ohne "da"] da auf ein synthetisches Dendrimer-Molekül setzt, verwenden Forschende der Notre Dame University in Indiana (USA) ein natürliches Kohlenhydrat aus Zuckermais (ein „Phyto-Glykogen“), das bekanntermaßen gut im Körper abgebaut werden kann.
Die Herausforderung bei diesen Projekten ist, dass alles so justiert werden muss, dass die freigesetzte Menge Insulin genau zur Höhe des Blutzuckerspiegels passen muss. Dafür müssen die Forschungsteams die Bindung des Insulins in den Nanopartikeln genau justieren.
Beide Projekte haben das Stadium der Tierversuche erreicht. Mit Mäusen und Schweinen haben sie aussichtsreiche Ergebnisse erbracht. Die Erprobung der Medikamente mit Menschen steht aber noch aus.
Ein sich selbst steuerndes Insulin
Das Forschungsteam eines Unternehmens hat einen anderen Ansatz gewählt: Es hat das Insulin selbst so verändert, dass es ohne Bindung an einen anderen Stoff bei niedrigem Blutzuckerspiegel fast inaktiv wird.
Dazu haben die Forschenden den Insulinmolekülen an der einen Seite gewissermaßen einen Kopf verpasst und am anderen Ende einen Schwanz. Der „Kopf“ ist ein Molekül, das Glukose binden kann. Der Schwanz besteht im wesentlichen aus einem Glukose-Molekül. Das so zusammenmontierte „Insulin NNC2215“ benimmt sich gewissermaßen wie eine Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Dazu krümmt sich das Molekül, damit der „Kopf“ den „Schwanz“ erreicht.
Wird dieses Insulin NNC2215 gespritzt und trifft auf einen niedrigen Blutzuckerspiegel, verbleibt es in dieser Haltung; und krumm, wie es ist, passt es nicht an die Insulin-Rezeptoren der Zellen. Die bleiben deshalb für die Glukose verschlossen; und der Blutzuckerspiegel sinkt nicht weiter.
Doch steigt der Blutzuckerspiegel an – etwa durch eine Mahlzeit – dann beißen die „Köpfe“ der Insulinmoleküle auch bereitwillig in die vorbeischwimmenden ungebundenen Glukose-Moleküle und lassen dafür den „Schwanz“ los. Die Insulinmoleküle sind nicht länger verkrümmt und können nun wie gewöhnliches Insulin an die Insulin-Rezeptoren binden. Das öffnet die Zellen, und sie holen Glukose aus dem Blut.
Dieses Projekt ist schon einen wichtigen Schritt weiter vorangekommen als die Nanopartikel-Projekte: Denn das Insulin NNC2215 wird derzeit in Phase I-Studien mit Freiwilligen erprobt. Die Ergebnisse aus diesen Studien werden das weitere Projekt leiten: Im Idealfall kann das unveränderte NNC2215 dann auch mit Patientinnen und Patienten erprobt werden. Genauso könnte es sich aber auch als nötig erweisen, die Bereitschaft der Moleküle, die krumme oder die gerade Form anzunehmen, noch etwas nachzujustieren.
Andere Glukose-responsive Wirkstoffe
Ein anderes Unternehmen erprobt derzeit zwei verschiedene Wirkstoffmoleküle ebenfalls in Phase I mit Freiwilligen, die es "Glukose-sensitive Insulin-Rezeptor-Agonisten" nennt. Es sind also Wirkstoffe, die sich womöglich deutlich von natürlichem Insulin unterscheiden, die aber den Insulinrezeptoren auf den Zellen die Anwesenheit von Insulin vortäuschen können – vorausgesetzt, der Blutzuckerspiegel liegt gerade nicht auf einem tiefen Wert. Auch sie sind also Glukose-responsiv und kommen als Mittel für eine bessere Behandlung von Typ-1-Diabetes in Betracht.
Die Perspektive
Welches der Entwicklungsprojekte zuerst ans Ziel kommt, und ob und wann, ist derzeit offen. Die beschriebenen Projekte – und eine Reihe weiterer, die derzeit international vorangetrieben werden – machen aber deutlich, dass die Pharmaforschung entschlossen ist, Menschen mit Typ-1-Diabetes noch bessere Therapien zu bieten und sie von den damit einhergehenden Belastungen endlich zu befreien.
(1) Auch bei Diabetes Typ 2 ist die Blutzucker-Kontrolle beeinträchtigt. Das hat jedoch andere Ursachen und wird auch meistens anders behandelt.