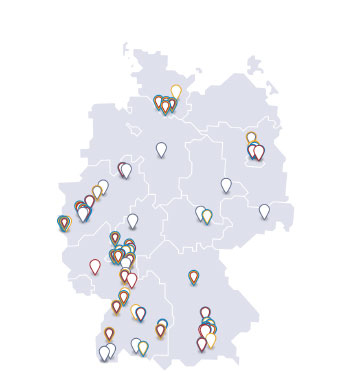Individuell gegen den Tumor - Innovative Therapien gegen Brustkrebs
Brustkrebs - Der häufigste Krebs bei Frauen
Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen: Etwa jede Zehnte erkrankt im Laufe ihres Lebens daran. In Deutschland werden laut Robert Koch-Institut, Berlin, rund 47.500 Brustkrebserkrankungen pro Jahr neu diagnostiziert – Tendenz steigend.

Regelmäßige Selbstuntersuchung der Brüste kann helfen, Gefahren frühzeitig zu erkennen.
Diese Seite ist dauerhaft auch über die Kurz-Adresse www.vfa.de/brustkrebs erreichbar.
Verglichen mit anderen europäischen Ländern liegt Deutschland damit im mittleren Bereich. In den Niederlanden, Dänemark, Finnland und Schweden tritt die Erkrankung am häufigsten auf; die wenigsten Brustkrebserkrankungen werden aus Spanien, Griechenland und Portugal gemeldet. Ansteigende Patientenzahlen werden aber in ganz Europa beobachtet; möglicherweise liegt es daran, dass europäische Frauen im Schnitt immer weniger Kinder bekommen, ihr erstes Kind immer später bekommen und die Früherkennung immer besser wird. Die Brust ist nicht irgendein Organ. Für viele Frauen ist sie eng verbunden mit dem Gefühl ihrer Attraktivität, mit ihrem Selbstwertgefühl, ihrem Sexualleben. Unsere Kultur verbindet sie mit Weiblichkeit und Erotik. Und dann ist sie ja noch zum Stillen da ...
Die Brust enthält Milchdrüsen und -gänge umgeben von Bindegewebe, das sie elastisch und fest macht. In den Lücken zwischen dem Drüsen- und dem Bindegewebe ist Fettgewebe eingelagert, dessen Menge und Verteilung die Form der Brust bestimmt.
Blut- und Lymphgefäße durchziehen die Brust. Die Blutgefäße versorgen das Gewebe mit Nährstoffen und Sauerstoff. Die Lymphgefäße leiten überschüssige Gewebsflüssigkeit, die alle Zellen umgibt, ins Blut ab. Sie führen dabei durch Lymphknoten hindurch. Diese sind mit weißen Blutkörperchen angefüllt, die versuchen, vorbeikommende Krankheitserreger aufzuhalten. Damit übernehmen sie eine Schutzfunktion. Viele Lymphgefäße der Brust führen durch Lymphknoten in der Nähe der Achselhöhle. Während des monatlichen Zyklus verändert sich die Brust. Sie reagiert auf die Hormone Östrogen und Gestagen, indem sie den Blutdurchfluss erhöht und mehr Flüssigkeit einlagert. Kurz vor der Monatsblutung können Knoten spürbar werden; sie bestehen großenteils aus Bindegewebe. All das bildet sich anschließend wieder zurück.
Tumoren in der Brust
 Die Brust ist von vielen Lymphbahnen (orangene Linien) durchzogen. Durch sie und die Lymphknoten darin (orangene Ovale) wird Gewebsflüssigkeit (Lymphe) in eine herznahe Vene (dunkelblau) abgeleitet. Krebszellen, die sich von einem Brusttumor abgelöst haben, können mit der Lymphe in die Blutgefäße und von dort in den ganzen Körper gelangen.Als „Tumor“ bezeichnen Ärzte jede Art von neu auftretender Geschwulst, unabhängig davon, ob sie gut- oder bösartig ist. Die meisten Tumoren der Brust sind gutartig (benigne): Einige Zellen des Binde- oder Fettgewebes vermehren sich übermäßig, bleiben aber als Klumpen zusammen und fangen nicht an, in Nachbargewebe einzudringen. Sie können meist ohne Probleme herausoperiert werden. In der Regel tritt danach kein weiterer Tumor auf.
Die Brust ist von vielen Lymphbahnen (orangene Linien) durchzogen. Durch sie und die Lymphknoten darin (orangene Ovale) wird Gewebsflüssigkeit (Lymphe) in eine herznahe Vene (dunkelblau) abgeleitet. Krebszellen, die sich von einem Brusttumor abgelöst haben, können mit der Lymphe in die Blutgefäße und von dort in den ganzen Körper gelangen.Als „Tumor“ bezeichnen Ärzte jede Art von neu auftretender Geschwulst, unabhängig davon, ob sie gut- oder bösartig ist. Die meisten Tumoren der Brust sind gutartig (benigne): Einige Zellen des Binde- oder Fettgewebes vermehren sich übermäßig, bleiben aber als Klumpen zusammen und fangen nicht an, in Nachbargewebe einzudringen. Sie können meist ohne Probleme herausoperiert werden. In der Regel tritt danach kein weiterer Tumor auf.
Bösartige (maligne) Tumoren entstehen fast immer aus Zellen der Milchgänge oder der Drüsenläppchen. Bösartig bedeutet: Die Zellen in dieser Geschwulst vermehren sich ohne Rücksicht auf Gewebegrenzen und können gesunde Zellen verdrängen. Zudem können sich einzelne Zellen vom Verband der anderen lösen und in die Lymphgefäße geschwemmt werden. Wenn sie durch diese zu einem Lymphknoten gelangen, verfangen sie sich zunächst darin. Schaffen sie es aber, den Lymphknoten zu passieren, dann folgen sie dem weiteren Verlauf des Lymphgefäßes bis in eine große Vene und gelangen so ins Blut. Mit dem Blut können sie dann in andere Organe gelangen, beispielsweise zur Leber, zur Lunge, in die Knochen oder ins Gehirn. Dort setzen sie sich schließlich fest und vermehren sich weiter. So bilden sie Tochtertumoren, Metastasen genannt. Die Metastasen sind das eigentlich Gefährliche an Brustkrebs – und nicht der Krebs in der Brust, der sich durch Operation meist gut entfernen lässt. Denn Metastasen können die Organe, in denen sie wachsen, schwer in Mitleidenschaft ziehen. Normalerweise ist das Immunsystem im Stande, neu entstandene Krebszellen zu erkennen und zu zerstören. Tumoren entstehen nur dann, wenn Krebszellen es schaffen, diesen Selbstschutz des Körpers zu unterlaufen.
Erste Krankheitszeichen
Am Anfang verursacht Brustkrebs keine Schmerzen oder sonstige Beschwerden. Dennoch können manchmal Veränderungen beobachtet werden, etwa neu auftretende Knoten oder Verhärtungen in der Brust, Veränderungen oder Absonderungen der Brustwarze, die Größenveränderung einer Brust oder ein Knoten in der Achselhöhle. Sie müssen nicht auf Krebs hindeuten, können es aber. Um die Ursache solcher Veränderungen festzustellen, stehen Ärzten verschiedene Diagnosemethoden zur Verfügung. Das wichtigste Verfahren ist die Mammographie, das Aufnehmen von Röntgenbildern der Brust. Auch eine Sonographie – eine Untersuchung mit Ultraschall – oder eine Kernspintomographie kann sinnvoll sein. Solche bildgebenden Verfahren reichen jedoch für eine sichere Diagnose nicht aus. Um Brustkrebs zweifelsfrei festzustellen, ist zusätzlich die „feingewebliche Untersuchung“ einer Probe aus dem Tumor nötig, eine Biopsie: Unter dem Mikroskop erkennen Spezialisten die Krebszellen an typischen Abweichungen ihrer Gestalt gegenüber gesunden Zellen. Mit weiteren Tests können sie auch wichtige Eigenschaften der Krebszellen bestimmen, etwa den Rezeptorstatus.
Was Zellen zu Krebszellen macht
Krebs beginnt mit einer einzigen Zelle, bei der einige Gene durch chemische Stoffe, Strahlen oder fehlerhaft verlaufene Stoffwechselprozesse in der Zelle beschädigt wurden. Die meisten Genschäden führen allerdings nicht zu Krebs. Vielmehr kann die Zelle sie reparieren, oder sie stirbt ab oder sie ist durch die Schäden nur in einigen Funktionen behindert, die nichts mit ihrer Vermehrungsfähigkeit zu tun haben. Gefährlich wird es nur, wenn Gene irreparabel beschädigt werden, die direkt mit der Kontrolle der Zellvermehrung zu tun haben. Das sind vor allem zwei Gruppen von Genen, die fachsprachlich Onkogene und Tumorsuppressorgene genannt werden. Beide Gengruppen arbeiten normalerweise in einer Zelle als Team zusammen und kontrollieren, dass sich die Zelle genau so oft teilt, wie es der Körper benötigt. Fallen jedoch entscheidende Teammitglieder aus, oder werden sie überaktiv, gerät das System aus seinem ausbalancierten Gleichgewicht und unkontrollierte Vermehrung ist die Folge. Die Zusammenarbeit der beiden Gen-Gruppen ähnelt der Funktionsweise eines Autos: Die Onkogene gleichen dem Gaspedal, die Tumorsuppressorgene den Bremsen. Wird das Gaspedal zu stark betätigt – dies entspricht der Veränderung eines Onkogens – gerät der Wagen ebenso wie die Zelle außer Kontrolle. Gleiches kann sich ereignen, wenn die Bremsen versagen – dies entspricht der Mutation eines Tumorsuppressorgens. Die Entscheidung, sich zu teilen, trifft eine gesunde Zelle aber nicht alleine. Vielmehr achtet sie auf Signale, die sie zur Teilung auffordern. Die Signale erreichen sie in Form von Botenstoffen, die von anderen Zellen gebildet und verbreitet wurden. Kommen sie von weit her, etwa aus den Eierstöcken, heißen sie Hormone, kommen sie aus nächster Nähe innerhalb der Brust, heißen sie Wachstumsfaktoren. Für jeden Botenstoff verfügt die Drüsenzelle über eigene „Empfangsantennen“ – so genannte Rezeptoren. So hat sie beispielsweise Östrogenrezeptoren, um das weibliche Geschlechtshormon Östrogen wahrzunehmen, das in den Eierstöcken, Muskeln und im Fettgewebe gebildet wird. Schütten die Eierstöcke gerade kein Östrogen aus – etwa gegen Ende des Menstruationszyklus – teilt sich die Drüsenzelle seltener.
Brustkrebszellen sind in mehrfacher Hinsicht außer Kontrolle geraten. Trotzdem halten sie in der Mehrzahl der Fälle daran fest, sich nur zu teilen, wenn sie Östrogen empfangen. Manche stellen sogar besonders viele Östrogenrezeptoren her und reagieren dann besonders stark auf Östrogen. In anderen Fällen haben sich die Krebszellen aber so verändert, dass sie sich auch ohne Östrogene häufig teilen können.
Bei rund einem Viertel der Brustkrebspatientinnen weisen die Tumorzellen eine Überzahl so genannter HER2-Rezeptoren auf, die einen Wachstumsfaktor empfangen. Diese Zellen reagieren auf diesen Wachstumsfaktor mit überschießender Vermehrung. Mittlerweile haben Forscher noch etliche weitere Rezeptoren entdeckt, die ebenfalls bei manchen Fällen von Brustkrebs in großer Überzahl auftreten.
Einfluss der Erbanlagen
Brustkrebs wird durch Gendefekte in einzelnen Drüsenzellen verursacht, die plötzlich irgendwann im Leben auftreten. Doch tragen zur Krebsentstehung mitunter auch Gene bei, die bereits bei den Eltern, Großeltern oder noch älteren Vorfahren einen Defekt erhalten haben und seither in dieser Form weitervererbt werden. Solche Gene machen nicht krank, aber anfällig für Krebs. Bei fünf bis zehn Prozent aller Brustkrebsfälle, so wird geschätzt, könnte eine solche ungünstige Erbanlage eine maßgebliche Rolle spielen. Das gilt insbesondere für Frauen, die ein defektes Gen BRCA-1 oder BRCA-2 geerbt haben. Ihr Risiko, bis zum 85. Lebensjahr an Brustkrebs zu erkranken, beträgt 85 Prozent – das Risiko anderer Frauen nur 10 Prozent. Die Abkürzung BRCA steht für englisch breast cancer, und entsprechend werden BRCA-1 und -2 häufig als Brustkrebsgene bezeichnet. Das ist in sofern irreführend, als die intakten BRCA-Gene gerade vor Brustkrebs schützen – es sind Tumorsuppressorgene. Erst wenn dieser Schutz versagt, wie im Fall von Gendefekten, kann das zu Brustkrebs führen. Die meisten Defekte in BRCA-1 und -2 können heute mit Hilfe eines Labortests erkannt werden.
Es gibt noch weitere Gene, die, wenn defekt, das Risiko für Brustkrebs vergrößern, jedoch in geringerem Maße.
Auch Männer erkranken an Brustkrebs
Brustkrebs kann auch Männer treffen. In ihrer Brust gibt es ebenfalls Zellen, die beginnen können, sich unkontrolliert zu teilen und zu metastasieren. Das Robert Koch-Institut in Berlin zählt jährlich allerdings nur 400 neu erkrankte Männer gegenüber 47.500 neu erkrankten Frauen. Gefährdet sind vor allem Männer, in deren Familie gehäuft Brustkrebs aufgetreten ist. Ein erhöhtes Risiko haben aber auch Kraftsportler, wenn sie den Aufbau ihrer Muskeln mit Anabolika oder anderen Hormonen fördern. Hoher Alkoholkonsum kann durch eine Störung des Hormonsystems benfalls das Risiko anheben. Die Behandlung von Brustkrebs bei Männern entspricht der bei Frauen.
Die Kapitel dieses Artikels / Mehr zum Thema
Brustkrebs - Der häufigste Krebs bei Frauen