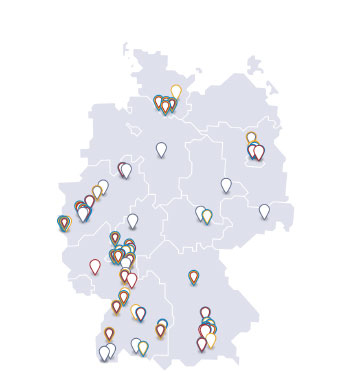Zonisamid im Alltag der Epilepsiepatienten (ZADE)
Titel der Studie/Acronym
Zonisamid im Alltag der Epilepsiepatienten (ZADE)
Zielsetzung/Fragestellung
Die von einer deutschen Ethikkommission mit positivem Votum bewertete NIS erfasst Zonisamid im Alltag der Epilepsiepatienten
Indikation
- Partielle Anfälle mit oder ohne sekundäre Generalisierung (Zusatztherapie)
Wirkstoff
- Zonisamid (deutsch)
Handelsname(n)
Zonegran
Geplante Anzahl vorgesehener Studienzentren: für die Untersuchung insgesamt
ca. 300
Geplante Patientenzahl: für die Untersuchung insgesamt
ca. 500
Kontaktperson
Rueß, Stefan
Projektleiter
GKM Gesellschaft für Therapieforschung mbH
Lessingstr. 14
80336 München
Deutschland
s.ruess@gkm-therapieforschung.de
Telefon: 089/209120-0
Telefax: 089/209120-30
Unternehmen
Eisai GmbH
Lyoner Str. 36
60528 Frankfurt
Deutschland
Stand der Information
01.06.2010
Status der Studie
Studie bereits abgeschlossen
Zusammenfassung der Ergebnisse
Methodologie
Primäres Studienziel:
Untersuchung der Wirksamkeit und Verträglichkeit von Zonisamid an einem größeren Kollektiv von Epilepsiepatienten in der täglichen medizinischen Praxis in Deutschland und Österreich.
Sekundäre Studienziele:
Einfluss der Zonisamid-Therapie auf die Lebensqualität
Gewinnung von Erkenntnissen zum Verordnungsverhalten sowie zur Beachtung der Fach- und Gebrauchsinformationen
Studiendesign:
Nicht-interventionelle Studie
Arzneimittel, Dosierung und Titration:
Zonegran® Hartkapseln
Die empfohlene anfängliche Tagesdosis von Zonisamid beträgt 50 mg, aufgeteilt in zwei Einzeldosen. Nach einer Woche kann die Dosis auf 100 mg täglich und anschließend in wöchentlichen Abständen in Schritten von bis zu 100 mg weiter erhöht werden, wobei sich Tagesdosen von 300 bis 500 mg als wirksam erwiesen haben.
Der Arzt sollte bei der Aufnahmeuntersuchung angeben, welche Zieldosis er für den Patienten anstrebt und in welchen Schritten er diese erreichen möchte.
Anwendungsdauer:
Im Anschluss an eine retrospektive Ausgangsphase sollte die Anfallssituation zu Beginn der Studie sowie nach etwa 4 Monaten im Rahmen einer Abschlussuntersuchung dokumentiert werden.
Referenztherapie:
Keine
Analysierte Anzahl der Patienten
365
Diagnose und Einschlußkriterium
Männliche und weibliche Patienten im Alter ab 18 Jahren mit der Diagnose fokale Epilepsie mit oder ohne sekundäre Generalisierung waren in die Studie eingeschlossen. Für die Studienteilnahme war vorausgesetzt:
die Behandlung mit mindestens einem Antiepileptikum zu Studienbeginn
keine psychiatrische Vorerkrankungen (Psychose u. ä.), Alkohol- und/oder Drogenmissbrauch oder schnell progrediente Erkrankungen des zentralen Nervensystems (z.B. Tumor, Demenz, Demyelinisierung).
Wirkliche Dauer der Studie
14 Monate
Wirksamkeit unter Alltagsbedingungen
Anfallssituation (Art und Häufigkeit in den letzten 8 Wochen vor Studienende)
Allgemeine Einschätzung des Gesundheitszustands durch Arzt und Patient (5-stufige Rangskala von sehr gut bis schlecht)
Für den Patienten sinnvoll nutzbare Zeit (Std./Tag)
Gesamtbeurteilung der Therapiezufriedenheit durch den Arzt (5-stufige Rangskala von sehr gut bis schlecht)
Gesamtbeurteilung der Anfallsfrequenz, Anfallsschwere und Therapiezufriedenheit durch den Patienten (5-stufige Rangskala von sehr gut bis schlecht)
Fragebogen QOLIE-10-P zur Lebensqualität bei Epilepsie (Teil A: 10 Items, Teile B und C: jeweils 1 Item)
Sicherheit
Verträglichkeit:
Unerwünschte Arzneimittelwirkungen
Abschließende Beurteilung der Verträglichkeit durch Arzt und Patient (5-stufige Rangskala von sehr gut bis schlecht)
Andere
Compliance:
Einhaltung des Titrationsschemas
Gesamtbeurteilung der Führbarkeit und Compliance durch den Arzt (5-stufige Rangskala von sehr gut bis schlecht)
Methoden
Statistische Methoden:
Generell erfolgt die Auswertung nur mittels deskriptiver statistischer Methoden. Quantitative Variablen werden durch basisstatistische Kenngrößen wie Mittelwert und Standardabweichung beschrieben. Außerdem werden ausgesuchte Quantile (1 %-Quantil, unteres Quartil (25 %), Median (50 %), oberes Quartil (75 %), 99 %-Quantil) der Verteilung berechnet. Die Anzahl der validen Daten wird stets mit angegeben. Für qualitative und ordinal skalierte Variablen werden absolute und relative Häufigkeitsverteilungen berechnet. Die Prozentuierung erfolgt im Allgemeinen sowohl unter Berücksichtigung der fehlenden Daten als eigene Gruppe als auch auf der Basis der validen Daten. Bei Subgruppenanalysen wird nur auf die Gesamtzahl valider Daten prozentuiert. Bei ausgewählten quantitativen Variablen werden nach geeigneter Gruppierung der Daten ebenfalls Häufigkeitsverteilungen berechnet. Antiepileptische Vor- und Begleitmedikation sowie nicht-antiepileptische Begleitmedikamente werden nach dem ATC/DDD Index 2009 kodiert und mit Hilfe von Inzidenzraten ausgewertet. Bei antiepileptischen Präparaten wird der Kodierungslevel 5 verwendet (chemische Substanz), bei den sonstigen Begleitmedikationen Level 2 (therapeutische Hauptgruppe). Begleiterkrankungen und unerwünschte Ereignisse (UEs) werden nach MedDRA® kodiert und mit Hilfe von Inzidenzraten auf den Ebenen Organsystem (System Organ Class) und Hauptbegriff (Preferred Term) ausgewertet.
Ergebnisse zur Wirksamkeit unter Alltagsbedingungen
Hauptziel dieser nicht-interventionellen Studie war die Untersuchung der Wirksamkeit und Verträglichkeit von Zonisamid an einem größeren Kollektiv von Epilepsiepatienten in der täglichen medizinischen Praxis in Deutschland und Österreich. Weitere Untersuchungsziele waren der Einfluss der Zonisamid-Therapie auf die Lebensqualität sowie die Gewinnung von Erkenntnissen zum Verordnungsverhalten und zur Beachtung der Fach- und Gebrauchsinformationen im therapeutischen Alltag.
Es ergaben sich auswertbare Daten von 365 Patienten. Das Durchschnittsalter betrug 45.5 Jahre. Im Mittel lag die Erstdiagnose der epileptischen Erkrankung 15.2 Jahre zurück (Median: 10.2 Jahre). In 27.7% der Fälle wurden die Anfälle als einfach fokal klassifiziert und bei 62.7% der Patienten als komplex fokal. Sekundär generalisierte Anfälle waren bei 57.3% der Patienten dokumentiert.
Häufigste Wirkstoffe einer begleitenden antiepileptischen Therapie waren Valproinsäure (28.5%), Carbamazepin (26.3%), Lamotrigin (25.8%) und Levetiracetam (21.6%).
Eine unzureichende Anfallskontrolle durch die aktuelle Medikation war der vorherrschende Grund für die Einstellung auf Zonisamid (91.0% der Patienten).
In 69.9% der Fälle wurde die Zonisamid-Behandlung mit der empfohlenen Anfangsdosierung von 50 mg/Tag begonnen. Die mittlere Tagesdosis betrug bei Beobachtungsbeginn 44 mg und stieg bis zur Abschlussuntersuchung nach durchschnittlich 18 Wochen kontinuierlich auf 260 mg an.
Im Mittel ging die Anfallshäufigkeit von 8.2 auf 3.4 zurück. Dieses Ergebnis wird dominiert von Patienten mit einer sehr hohen Anfallsfrequenz, was sich in den vergleichsweise niedrigeren Werten der Mediane widerspiegelt (Rückgang von 4 auf 1). Insgesamt ging bei 85.8% der Patienten die Zahl der Anfälle zurück, bei 5.8% nahm sie zu.
Die Responderrate (Kriterium: Rückgang der Anfallshäufigkeit um mindestens 50%) betrug 78.6%. Am Ende der Beobachtungsphase waren 36.0% der Patienten anfallsfrei. Subgruppenanalysen zeigten, dass die Responderrate umso größer war, je jünger die Patienten waren und je kürzer sie an Epilepsie litten.
Eine Verbesserung des Gesundheitszustands bis zur Abschlussuntersuchung ergab sich in 50.7% (Arzturteil) bzw. 51.4% (Patientenurteil) der Fälle. Eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes trat nur bei 7.4% bzw. 6.3% der Patienten auf.
Der Gesamtscore QOLIE-10-P Teil A zur Lebensqualität bei Epilepsie verbesserte sich im Mittel von 2.9 auf 2.4 Punkte. In Teil B des QOLIE-10-P ergab sich bei 61.6% der Patienten zwischen Aufnahme- und Abschlussuntersuchung eine Verbesserung in der Beurteilung, bei 7.0% eine Verschlechterung.
Die globale Therapiezufriedenheit wurde von den Ärzten in 81.6% der Fälle als sehr gut oder gut bewertet, bei den Patienten selbst waren es 80.7%. Die Anfallsfrequenz wurde von 79.4% der Patienten am Ende der Beobachtungsphase als sehr gut oder gut eingeschätzt, die Anfallsschwere von 81.7%.
Ergebnisse zur Sicherheit
Verträglichkeit:
In 91.8% der Fälle urteilten die Ärzte bei der Abschlussuntersuchung global die Verträglichkeit mit sehr gut oder gut, bei den Patienten waren es 86.9%. Eher schlecht oder schlecht ergab sich in 3.7% (Ärzte) bzw. 4.5% (Patienten) der Fälle. Bei 46 Patienten (12.6%) wurden insgesamt 88 unerwünschte Ereignisse dokumentiert. In 71 Fällen handelte es sich um unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAWs), bei denen der Kausalzusammenhang mit Zonisamid vom Arzt nicht ausgeschlossen werden konnte. Insgesamt 32 Patienten (8.8%) hatten zumindest eine UAW, am häufigsten wurden Übelkeit (8 Patienten, 2.2%), Gewicht erniedrigt (7 Patienten, 1.9%) und Ermüdung (4 Patienten, 1.1%) genannt. Gemäß Beurteilung durch den Arzt wurden 8 der 71 UAWs (bei 6 Patienten) als schwerwiegend klassifiziert.
Ergebnisse zu anderen Parametern
Compliance:
Die Führbarkeit bzw. Compliance des Patienten wurde vom Arzt in 92.4% bzw 93,2% der Fälle als sehr gut oder gut eingeschätzt.
Schlussfolgerungen
Die ZADE-Studie war darauf ausgerichtet, die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Zonisamid an einem größeren Kollektiv von Epilepsiepatienten in der täglichen medizinischen Praxis in Deutschland und Österreich zu dokumentieren. Zusammenfassend belegen die Ergebnisse dieser nicht-interventionellen Studie, dass Zonisamid nicht nur bei therapierefraktären Patienten mit langer Erkrankungsdauer, sondern insbesondere auch bei Patienten mit weniger schwer behandelbarer Epilepsie bzw. früh im Erkrankungsverlauf als Zusatz zu einer bestehenden Monotherapie eine wirksame und gut verträgliche Therapieoption für die tägliche Praxis darstellt.